Geteilte Autorschaft: Goethe und Schiller - Visionen des Dichters, Realitäten des Schreibens
Impressum
I.
"Da streiten sich die Deutschen, wer größer sei, Schiller oder ich. Froh sollten sie sein, daß sie zwei solche Kerle haben, über die sie streiten können"[1] - So zitiert Thomas Mann aus Eckermanns Gesprächen mit Goethe. Dies freilich ungenau, ist doch im Originaltext weder von den "Deutschen" die Rede - sondern ganz allgemein vom "Publikum", noch sind es "zwei solche Kerle" - sondern "überhaupt ein paar Kerle", "worüber sie streiten können."[2] Daß Thomas Mann daraus aber die trinitarische Gruppe einer säkularen Dreieinigkeit der "Deutschen" und ihrer "zwei Kerle" macht, ist eine aufschlußreiche Zitat-Verschiebung, die eigentlich schon fast alles sagt; über den Rest möchte ich hier reden.
'Kritische Bilanz' über Goethe und seinen Zeitgenossen Schiller zu ziehen - wie es das Rahmenthema dieser Jahresversammlung will - ist eine zweifelhafte Angelegenheit. Nicht, daß eine kritische Bilanz hier im Vergleich zu den übrigen im wissenschaftlichen Programm der Tagung ins Auge gefaßten Zeitgenossen und geistigen Bewegungen besonders schwierig oder gar unmöglich wäre - eher das Gegenteil trifft zu: Problematisch wird die Sache gerade deshalb, weil hinsichtlich der Zeitgenossenschaft 'Schiller-Goethe' in den vergangenen zweihundert Jahren kaum je etwas anderes getan wurde als Bilanz zu ziehen, ob kritisch oder unkritisch, mit einem Gewinn- oder einem Verlustsaldo unter dem Strich, ist bereits von zweitrangiger Bedeutung. Entscheidend dagegen der Tatbestand, daß in der Art und Weise, wie die Verbindung zwischen Goethe und Schiller wahrgenommen und wie sie gedeutet wurde, von allem Anfang an die Buchhaltung herrscht. Variabel mochten die Posten sein, die jeweils in die Bilanz einbezogen und gegeneinander aufgerechnet wurden: der Mensch Goethe gegen den Menschen Schiller, der eine Schriftsteller gegen den andern, Goethe und Schiller gemeinsam gegen ihr Umfeld und die andern Zeitgenossen; und schließlich nicht zu vergessen die Bilanzierung von Schiller&Goethe als Aktivposten im realen wie im symbolischen Bruttoinlandprodukt der deutschen Nation sowie als Exportfaktoren in der kulturellen Außenhandelsbilanz Deutschlands. Wie immer aber die Rechnung aufgetan wurde, aufgerechnet und abgerechnet wurde immer, vom individualpsychologischen Abwägen von Synergie-Gewinnen oder Reibungsverlusten zwischen beiden bis hin zur Saldierung in der gesamtdeutschen Nationalbuchhaltung.
So sehe ich mich vor der unerfreulichen Alternative, entweder - in Erfüllung der Rahmenthematik der Tagung - erneut das zu tun, was eh und je schon getan wurde, oder aber der Aufgabenstellung untreu zu werden. Ich möchte mich dem Dilemma dadurch entziehen, daß ich im folgenden nicht einfach eine weitere Bilanz der Verbindung Goethes mit Schiller zu präsentieren suche, sondern vielmehr gerade über jenen Tatbestand einige Ü berlegungen anstellen werde, daß diese Verbindung derart stark unter dem Gesetz der Bilanzierung, mithin der Buchhaltung, steht. Nicht eine kritische Bilanz also, sondern eine Kritik der Bilanz bzw. eine Analyse des Phänomens der Bilanzierung als topologischer Grundfigur im Verhältnis Goethes zum Zeitgenossen Schiller.
Mit der Figur des Bilanzierens verbunden ist eine weitere Figur, auch sie topologisch in der deutschen Klassikerrezeption; sie schlägt sich in der bohrenden Frage nieder: Was war es denn nun eigentlich zwischen den beiden? Diese Frage nach der 'wirklichen' Natur in der Verbindung von Schiller und Goethe impliziert, daß es darin einen Vordergrund oder eine Oberfläche einerseits und Verborgenes, Verstelltes oder Entstelltes andererseits gibt. Am schärfsten wohl hat die Fragestellung Hans Mayer in seinem Buch Goethe. Ein Versuch über den Erfolg (1973) artikuliert und zugleich festgehalten, was sich zwischen unsern Blick auf die beiden und die "wahre" Wirklichkeit ihrer Verbindung schiebt: "Wo findet sich das Reale hinter so viel nachträglicher und auch schon gleichzeitiger Stilisierung?"[3] -- 'Stilisierung' ist das Stichwort.[4]
Die nachträglichen Stilisierungen von Wilhelm v. Humboldt über die bürgerlich deutsch-nationale Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts und die National-Ikone von Ernst Rietschels Dioskuren-Denkmal bis hin zu Thomas Mann sind bekannt und inzwischen auch oft genug, z.B. unter dem Stichwort der Klassik-Legende, kritisch reflektiert worden. Wiederum Mayer: "Alles scheint überwachsen vom Unkraut des Heroenkults." Jürgen Linke hat in diesem Zusammenhang von einem Konvergenz-Mythos Goethe-Schiller als diskurskonstitutivem Prinzip deutscher Literaturgeschichtsschreibung im 19. Jahrhundert gesprochen, der ganz den Charakter einer "mythische[n] Hochzeit, ein[es] Hieros Gamos" trage und worin sich fundamentale antagonistische Tendenzen des Zeitalters vermittelnd versöhnen ließen.[5]
Unter den Urhebern zeitgenössischer Stilisierungen sieht Hans Mayer Goethe selbst schon am Werk, habe dieser doch "solche Idolatrie nicht gehindert, gelegentlich ermutigt." Ja, ihm habe "nicht bloß an der Stilisierung und nachträglichen Manifestation von Freundschaft und geistig-poetischer Ü bereinstimmung" gelegen. "Er wollte vor der deutschen Öffentlichkeit eine Allianz bekräftigen, deren Solidität und Homogeneität früher schon von vielen, durchaus nicht allein von Böswilligen, bezweifelt wurde."[6]
Hans Mayers Unterscheidung von 'Realem' und 'Stilisierung' im literaturgeschichtlichen Epochenereignis von Schillers und Goethes Zusammentreffen und seine Frage nach dem Real-Substrat in deren Verbindung ist ebenso typisch für diesen Topos in der Klassikforschung, wie sein Verfahren der ideologiekritischen Mythenzertrümmerung bei solcher Fragestellung fast unvermeidlich ist. Wo er selbst z.B. "das glückliche Ereignis", wie Goethe im Titel zu seinem späteren Bericht die Begegnung mit Schiller nennt, kalauernd in "ein schmerzhaftes Erleidnis" und in der Schlußbilanzierung gar zu einem "Mißerfolg in Goethes Existenz" umbucht - wenn auch "in einem ungemein produktiven, darum eben besonders quälenden Sinne", da sehen andere "Mißverständnisse", wenn auch "fruchtbare"[7], oder "Vor-Urteile"[8] walten, und wieder andere legen im Verhältnis der beiden das 'Reale' einer letztlich zweckrationalen "politischen Freundschaft", eines "politischen Blocks auf kulturell-ideologischem Gebiet" bloß, [9] oder sehen darin den Zusammenschluß der "getrennten Reiche [zweier Herrscher] zu einer strategischen Einheit", einem "Condominium"[10], oder sie deuten die Freundschaft als "Interessengemeinschaft"[11], ein "taktisches Bündnis"[12].
Noch der Titel des Sammelbands eines Symposiums der Deutschen Schillergesellschaft von 1982 über Goethes und Schillers Literaturpolitik widerspiegelt mit der Zitatenübernahme des ökonomischen Begriffs "Unser Commercium" aus dem Briefwechsel Goethe-Schiller - bei aller Vielfalt der geltend gemachten Gesichtspunkte - die Suche nach einem handfest Realen hinter den mythischen Stilisierungen.[13]
Gegenüber solchen Tendenzen, ein 'Reales' von den sog. 'Stilisierungen' abzuspalten und als das eigentlich Wirkliche und Wahre an der Verbindung zwischen Goethe und Schiller aufzudecken, sei hier die These vertreten, (a) daß gerade die Stilisierung das Reale sei, (b) daß als konstitutives Moment der Stilisierung die bilanzierende Grundfigur in die Verbindung der beiden eingeführt werde und (c) daß Stilisierung wie Buchhaltung ihre Begründung im sozialen Entwicklungsprozeß des modernen Schriftstellers finden, wie er sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts herauskristallisierte und wie er von Schiller und Goethe so real erfahren wie bewußt wahrgenommen wurde.
II.
Vergegenwärtigen wir uns zunächst in wenigen Zügen Entstehung und Entwicklung ihrer Verbindung, möglichst ohne alle deutenden Zugaben - was auf eine erneute Stilisierung unsererseits hinauslaufen könnte, dafür mit einem besonderen Augenmerk auf jene Momente, welche in der Beziehungsentwicklung selbst diesen Charakter haben:
Am 13. Juni 1794 wendet sich Schiller an Goethe mit dem Wunsch, dieser möge sich am Zeitschriftenunternehmen der Horen mitbeteiligen, das er selbst zusammen mit Humboldt, Fichte und Woltmann zu gründen im Zuge sei. Goethe antwortet zehn Tage später, er "werde mit Freuden und von ganzem Herzen von der Gesellschaft sein." [14] Unmittelbar darauf berichtet er an Frau von Kalb: "Noch muß ich sagen, daß seit der neuen Epoche auch Schiller freundlicher und zutraulicher gegen uns Weimaraner wird, worüber ich mich freue und in seinem Umgange manches Gute hoffe."[15] Am 20. Juli kommt es im Anschluß an eine Sitzung in der Naturforschenden Gesellschaft zu einem Gespräch zwischen beiden, das Goethe in seinem schon erwähnten späteren Bericht mit "glückliches Ereignis" überschreibt und als "glückliches Beginnen [...] eines zehnjährigen Umgangs" bis zu Schillers Tod bezeichnet. Zwei Tage später ist Goethe zusammen mit den Schillers bei Humboldts zum Nachtessen eingeladen.
Das Nächste, wovon wir wissen, ist neben einer kleinen Notiz Goethes an Schiller ein langer Brief Schillers vom 23. August, fünf Tage vor Goethes fünfundvierzigstem Geburtstag. Wohl einer der bemerkenswertesten Briefe in der deutschen Literaturgeschichte überhaupt, ist er auch ein Schlüsseldokument in der Verbindung Goethe-Schiller. Denn mit diesem Brief bereits kommt die Semantik der Bilanzierung ins Spiel, und ebenso setzt hier die "Stilisierungs"-Arbeit in der Beziehungsgestaltung zwischen den beiden in einem ersten energischen Zugriff Schillers mit bemerkenswerter Entschiedenheit ein. Er schreibt: "über so manches, worüber ich mit mir selbst nicht recht einig werden konnte, hat die Anschauung Ihres Geistes [(...)] ein unerwartetes Licht in mir angesteckt. Mir fehlte das Objekt, der Körper, zu mehreren spekulativischen Ideen, und Sie brachten mich auf die Spur davon."[16] Nicht nur mit einer kühnen Metaphorik, sondern überhaupt in einem höchst kühnen Verfahren schreibt Schiller - wie er selbst sagt - dem "Körper" Goethe seine eigenen ästhetischen Ideen ein und entwirft auf diesem begrifflichen Grundriß in wenigen Strichen ein Gesamtbild von Goethes künstlerischem Habitus. - Wir werden auf dieses Schlüsseldokument zurückkommen.
Goethe reagiert wohlwollend, wobei er freilich in unüberhörbarer Ironisierung den impliziten Bilanzierungsgestus in Schillers Verfahren als solchen ausspricht: "Zu meinem Geburtstag, der mir diese Woche erscheint, hätte mir kein angenehmer Geschenk werden können als Ihr Brief, in welchem Sie, mit freundschaftlicher Hand, die Summe meiner Existenz ziehen [kurs. v. Verf.] und mich, durch Ihre Teilnahme, zu einem emsigeren und lebhafteren Gebrauch meiner Kräfte aufmuntern."[17] Im gleichen Brief vom 27. August schlägt Goethe vor, daß man sich "wechselseitig die Punkte [klar] macht, wohin wir gegenwärtig gelangt sind, so werden wir desto ununterbrochener gemeinschaftlich arbeiten können."[18] Und am 4. September stellt wiederum Goethe fest: "[...] daß uns nicht allein dieselben Gegenstände interessieren, sondern daß wir auch in der Art sie anzusehen meistens übereinkommen. Ü ber alle Hauptpunkte, sehe ich, sind wir einig, und was die Abweichungen der Standpunkte, der Verbindungsart, des Ausdrucks betrifft, so zeugen diese von dem Reichtum des Objekts und der ihm korrespondierenden Mannigfaltigkeit der Subjekte.[19] Er lädt Schiller für vierzehn Tage zu sich nach Weimar ein und schreibt nach dessen Abreise: "Wir wissen nun, mein Wertester, aus unsrer vierzehntägigen Konferenz: daß wir in Prinzipien einig sind und daß die Kreise unsers Empfindens, Denkens und Wirkens teils koinzidieren, teils sich berühren; daraus wird sich für beide gar mancherlei Gutes ergeben."[20] Wie ein wechselseitiges Abkommen, förmlich formell mit Präambel und Resolution - man denkt unwillkürlich an den gelernten Juristen und Geheimrat Goethe, muten schließlich dessen Sätze im Brief vom Oktober an, die der Annäherungsphase einen gewissen Abschlußcharakter verleihen, den eines Vertragsabschlusses gleichsam:
"Da wir beide bekennen, daß wir dasjenige noch nicht wissen, wenigstens noch nicht deutlich und bestimmt wissen, wovon wir uns soeben unterhalten, sondern vielmehr suchen [das klassische Kunstwerk, Anm. d. Verf.]; da wir einander nicht belehren wollen, sondern einer dem andern nachzuhelfen und ihn zu warnen denkt, wenn er, wie es nur leider gewöhnlich geschieht, zu einseitig werden sollte: so lassen Sie mich vollkommene Kunstwerke gänzlich aus den Augen setzen, lassen Sie uns erst versuchen, wie wir gute Künstler bilden, erwarten, daß sich unter diesen ein Genie finde, das sich selbst vollende; lassen Sie uns ihm nachspüren, wie es sich selbst unbewußt dabei zu Werke gehe, und wie das schönste Kunstprodukt, eben wie ein schönes Naturprodukt, zuletzt nur gleichsam durch ein unaussprechliches Wunder zu entstehen scheine."[21]
In knapp vier Monaten hatte sich damit jene literarisch-künstlerische, berufliche und persönliche Verbindung zwischen Goethe und Schiller herausgebildet, gegen die zuvor jede Wahrscheinlichkeit gesprochen hatte. Von Goethe sind nur wenige Äußerungen über Schiller aus der Zeit vor ihrer Begegnung überliefert. Wir sind daher gezwungen, auf seine Bemerkungen darüber in Glückliches Ereignis zurückzugreifen; diese Erinnerungen sind freilich erst Jahre später niedergeschrieben worden und damit natürlich bereits dem Verdacht nachträglicher Stilisierung ausgesetzt - Jürgen Fohrmann spricht denn auch von einer "ex post vorgenommenen narrativen Inszenierung"[22], die u.a. gerade in der pointierten Festschreibung der lebensgeschichtlichen Daten auf die polaren Gegensätze einer klassischen Kulturerfahrung (Stichwort Italien) für Goethe und einem kruden deutschen Kraftgenie-Gebaren für Schiller sichtbar wird, worin sich wenn auch in verzerrender Zuspitzung auf unversöhnliche Gegenpositionen die spätere Komplementärkonstellation präfiguriert:
"Nach meiner Rückkunft aus Italien [...] fand ich neuere und ältere Dichterwerke in großem Ansehn, [...] leider solche, die mich äußerst anwiderten, ich nenne nur Heinses 'Ardinghello' und Schillers 'Räuber'. Jener war mir verhaßt, weil er Sinnlichkeit und abstruse Denkweisen durch bildende Kunst zu veredlen und aufzustutzen unternahm, dieser, weil ein kraftvolles, aber unreifes Talent gerade die ethischen und theatralischen Paradoxen, von denen ich mich zu reinigen gestrebt, recht im vollen hinreißenden Strome über das Vaterland ausgegossen hatte.
[...] ich vermied Schillern, der, sich in Weimar aufhaltend, in meiner Nachbarschaft wohnte. [...] und so lebten wir eine Zeitlang nebeneinander fort. [...] An keine Vereinigung war zu denken. [...] Niemand konnte leugnen, daß zwischen zwei Geistesantipoden mehr als ein Erddiameter die Scheidung mache, da sie denn beiderseits als Pole gelten mögen, aber eben deswegen in eins nicht zusammenfallen können."[23]
Zahlreicher sind demgegenüber von früher datierende Äußerungen von Schiller, die fast alle von hoher Gefühlsambivalenz zeugen und gelegentlich bis zu abstoßend brutaler Ausdrucksheftigkeit gehen können. So im Brief an seinen Freund Körner vom 2. Februar 1789:
"Öfters um Goethe zu sein, würde mich unglücklich machen. [...] Er ist an nichts zu fassen. Ich glaube in der Tat, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. [...] Er macht seine Existenz wohltätig kund, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben. [...] Ein solches Wesen sollten die Menschen nicht um sich herum aufkommen lassen. Mir ist er dadurch verhaßt, ob ich gleich seinen Geist von ganzem Herzen liebe und groß von ihm denke. Ich betrachte ihn wie eine stolze Prüde, der man ein Kind machen muß, um sie vor der Welt zu demütigen."[24]
Nachdem die Verbindung im Sommer und Frühherbst 1794 dann doch gegen alle Erwartungswahrscheinlichkeiten zustandegekommen war - Goethe selbst spricht vom "Dämonischen", das dabei obwaltete, [25] wird sie zu einer der fruchtbarsten literarischen Arbeitsgemeinschaften, die wir kennen.
Wiederum vorerst das Faktische betonend sind allein schon Umfang und Intensität des Wechselgesprächs, wie es aus dem Briefwechsel ablesbar ist, höchst beeindruckend: Ü ber tausend Briefe gehen in den zehn dreiviertel Jahren hin und her; in den vier Jahren ihrer intensivsten Korrespondenz 1796/99 und vor Schillers Umzug von Jena nach Weimar im Dezember 1799 sind es 574 Briefe, d.h. rund 140 pro Jahr bzw. alle zwei bis drei Tage ein Brief. Wie das Diagramm ihrer Verteilung auf die rund zehn Jahre veranschaulicht, erreicht die Korrespondenz in den Jahren 96/97 und 97/98 ihre größte Intensität, nicht nur nach der Anzahl der Briefe (156 bzw. 145), sondern auch nach deren Umfang (195 bzw. 237 Seiten[26]). Bis zum Umzug Schillers nach Weimar bleibt die Anzahl an Briefen relativ konstant, dagegen nimmt ihr Umfang stetig ab.
Korrespondenz Goethe - Schiller
13. Juni 1794 / Ende April 1805
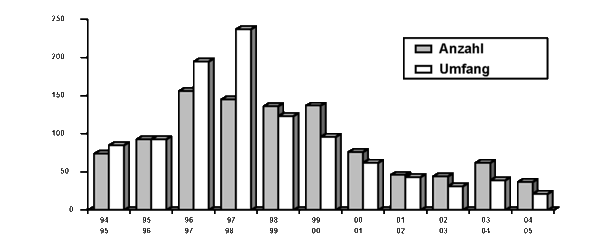
Was in diesem "Commercium durch die Botenfrau"[27] - wie Schiller es einmal nennt - ausgetauscht wurde und was damit auch die dokumentierte Substanz und das Fundament ihrer Verbindung konstituiert, ist weder auf einen zusammenfassenden Nenner zu bringen, noch im einzelnen rapportierbar; letzteres würde zu endlos aufzählenden Listen führen, ersteres die Verbindung ihrer ganzen Fülle entleeren. Das Gespräch reicht, um Christian Dietrich Grabbes indigniert-sarkastische Wendung aufzugreifen, von den "Erbärmlichkeiten des Privatlebens", wo der Leser selbst von ungezählten "Visiten- und Küchen-Charten" nicht verschont werde, [28] über praktische Fragen des literarischen Schaffen und des Kulturlebens bis hin zu de facto schon in den Briefen völlig literarisierten Formen des dialogischen Kunstgesprächs. Was die Verbindung über den brieflichen und auch mündlichen Austausch hinaus an Gehalten und Anstößen für das beiderseitige literarische Schaffen in sich trägt, läßt sich noch weniger in ein paar Worten ausdrücken - man verfahre denn wie Goethe selbst, der in einem Brief an den Berliner Staatsrat Schultz 1829 subtrahierend wegzählt, was nicht gewesen wäre:
"[...] wäre damals der Trieb und Drang nicht gewesen, den Augenblick auf's Papier zu bringen, so sähe in der deutschen Literatur alles anders aus. [...] Und ich weiß wirklich nicht, was ohne die Schillerische Anregung aus mir geworden wäre. [...] Hätt es ihm nicht an Manuscript zu den Horen und Musenalmanachen gefehlt, ich hätte die Unterhaltungen der Ausgewanderten nicht geschrieben, den Cellini nicht übersetzt, ich hätte die sämmtlichen Balladen und Lieder, wie sie die Musenalmanache geben, nicht verfaßt, die Elegien wären, wenigstens damals, nicht gedruckt worden, die Xenien hätten nicht gesummt, und im Allgemeinen wie im Besondern wäre gar manches anders geblieben."[29]
Diese "Abwahlliste" ließe sich mit Leichtigkeit erweitern; Eberhard Lämmert z.B. ergänzt sie durch folgende Posten:
"Vor allem aber wären der Meister-Roman und das trauliche Epos Hermann und Dorothea in den Augen der Nachwelt nicht zu solchen Musterformen gediehen, wenn nicht unter Schillers ständigem kritischen Zuspruch und in den sorgfältigen Ü berlegungen über die Eigentümlichkeiten von Epik und Dramatik die Musterhaftigkeit dieser erzählerischen Unternehmungen ständig vor beider Augen gestanden hätte."[30]
All diese höchst wahrscheinlich ausgebliebenen Schaffensergebnisse müssen wir nun unsererseits noch in Richtung auf Schiller ergänzen: Weder wären vermutlich seine beiden großen kunstphilosophischen Aufsätze Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen und Ü ber naive und sentimentalische Dichtung in jener abschließenden Form denkbar geworden, die ganz von jenem "Licht" erfüllt ist, das - wie Schiller im bereits erwähnten Geburtstagsbrief formulierte, "die Anschauung" von Goethes Geist in ihm "angesteckt" hatte. Noch wären, nicht zuletzt wegen des Weiterlaufens der poetologischen Kategorien des Naiven und Sentimentalischen in die lebensweltliche Typologie des Realisten und Idealisten die Figuren in Schillers Wallenstein-Trilogie möglich geworden, wie denn überhaupt der Wallenstein im Medium des Briefwechsels zu seinen Konturen findet. - Damit ist jedoch die hypothetische Liste des: "Was wäre nicht geworden, wenn nicht..." beileibe nicht abgeschlossen.
III.
Es ist nun freilich ungenau ausgedrückt, wenn wir sagen, Schillers kunstphilosophische Schriften der Mitte 90er Jahre wären ohne die Verbindung mit Goethe nicht denkbar; das Umgekehrte trifft auf seine Weise ebenso zu: Die Verbindung Goethe-Schiller ruht als künstlerische Lebenspraxis gleichermaßen auf jenen selben Grundgedanken auf, wie sie sich als ästhetische Theorie in Schillers Schriften niederschlagen. Wie ist dies zu verstehen?
Ü ber die Briefe zur ästhetischen Erziehung schreibt Schiller an Goethe: "Sie werden in diesen Briefen Ihr Porträt finden, worunter ich gern Ihren Namen geschrieben hätte, wenn ich es nicht haßte, dem Gefühl denkender Leser vorzugreifen."[31] Und erst recht gilt diese Anwesenheit Goethes im Text für Ü ber naive und sentimentalische Dichtung. Beide berühren sich darin mit Schillers Geburtstagsbrief vom 23. August 1794, daß in ihnen ein Typisierungsverfahren künstlerischer Schaffens- und Daseinsformen durchgeführt wird, deren eine Variante sich zwar unmittelbar in Goethe verkörpert bzw. wozu Goethe den "Körper", die real-ideale Gestalt liefert, worin aber zugleich die Gestalt Schillers komplementär mitgedacht ist.
Das hier eingeleitete Typisierungsverfahren ist nun aber nicht bloß ein theoretischer Abstraktvorgang, vielmehr bildet es ebenso die Grundlage und den Ausgangspunkt der vielberufenen und oft kritisierten "Stilisierung" in der Verbindung Goethe-Schiller: Sowohl unter 'Stilisierung' wie unter 'Typisierung' verstehen wir eine feste und vereinfachende Merkmalszuweisung nach kategoriellen Grundmustern, irreduziblen Eigenschaften oder sog. "typischen", d.h. regelhaften Handlungs- oder Verhaltensweisen - immer mit der Möglichkeit ihrer Erhöhung ins ideal Vor-Bildhafte (dies dann vor allem 'Stilisierung' im kritischen Sinne genannt) oder ihrer Abwertung ins Trivial-Ideologische - (dann als 'Stereotyp' oder 'Klischee' wahrgenommen). Nach dem bereits zitierten Satz im Geburtstagsbrief an Goethe, wonach ihm das "Objekt" zu seinen "spekulativen Ideen" gefehlt und dieser ihn "auf die Spur davon" gebracht habe, entwirft Schiller ein ausführliches Bild von Goethes Geistesentwicklung, das er wie folgt zusammenfassend abschließt:
"So ungefähr beurteilte ich den Gang Ihres Geistes, und ob ich recht habe, werden Sie selbst am besten wissen. Was Sie aber schwerlich wissen können [(...)], ist die schöne Ü bereinstimmung Ihres philosophischen Instinktes mit den reinsten Resultaten der spekulierenden Vernunft. Beim ersten Anblicke zwar scheint es, als könnte es keine größere Opposita geben als den spekulativen Geist, der von der Einheit, und den intuitiven, der von der Mannigfaltigkeit ausgeht. Sucht aber der erste mit keuschem und treuem Sinn die Erfahrung und sucht der letzte mit selbsttätiger freier Denkkraft das Gesetz, so kann es gar nicht fehlen, daß nicht beide einander auf halbem Wege begegnen werden."[32]
Daß dieser Geburtstagsbrief "ein genialer Wurf"[33] gewesen sei, habe Goethe gleich erkannt, schreibt Ilse Graham. Nicht nur ein genialer Wurf war es, sondern ein literaturpolitischer und kultursoziologischer Meisterstreich, und ich würde nicht anstehen zu behaupten, daß in diesem Brief als Handlungsakt, in den in ihm ausgelegten ersten Ordnungskategorien und in den daraus abgeleiteten Typisierungen sowie in dem, was daraus hervorgeht, die epochale literaturgeschichtliche Bedeutung des Ereignisses Goethe-Schiller angelegt sei.[34] Sein wegweisender Charakter tritt schon in der nächsten Briefrunde deutlicher hervor. War Schiller im ersten Brief insofern noch vorsichtig, als er eher abstrahierend und vor allem auf Goethe allein bezogen formulierte, so schreibt er nach dessen entgegenkommenden Reaktion schon im folgenden Brief vom 31. August 1794 sowohl Goethe wie sich selbst die Ordnung ihrer beiderseitigen geistigen Existenz nun direkt und unverhüllt auf den Leib:
"Ihr Geist wirkt in einem außerordentlichen Grade intuitiv, und alle Ihre denkenden Kräfte scheinen auf die Imagination, als ihre gemeinschaftliche Repräsentantin, gleichsam kompromittiert zu haben. [...] Mein Verstand wirkt eigentlich mehr symbolisierend, und so schwebe ich als eine Zwitter-Art zwischen dem Begriff und der Anschauung, zwischen der Regel und der Empfindung, zwischen dem technischen Kopf und dem Genie."[35]
Ausgehend von der binären Typologisierung in den intuitiven und spekulativen Geist bzw. eine Zwitterform davon weitet sich der von Schiller eingeleitete und von Goethe willig mitvollzogene Stilisierungsvorgang in der Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung des Andern auf einen Persönlichkeits-Stil aus, um schließlich in die Opposition des Naiven und Sentimentalischen als Verfahrenstypologien des Dichterischen bzw. des Realisten und Idealisten als Verhaltenstypologien in der Ich/Welt-Beziehung einzumünden. Diese sind - wie Peter Szondi gezeigt hat[36] - komplex vielschichtige Kategorien, in denen sowohl geschichtsphilosophische wie poetologische und charakterologische Typisierungskonstrukte ineinander greifen. Zugleich konstituieren die beiden Typisierungskonstrukte in der sozialen Konstellation ihrer Träger das, was Pierre Bourdieu einen sozialen Habitus nennt. Gemeint ist mit dieser grundlegenden Kategorie in Bourdieus Kultursoziologie die Art und Weise, wie ein Individuum aufgrund persönlicher Anlagen, pschychisch-charakterlicher Dispositionen und sozialisationsbedingter Prägungen gesellschaftlich in Erscheinung tritt und im sozialen Raum handelt:
"Insofern unterschiedliche Existenzbedingungen unterschiedliche Formen des Habitus hervorbringen [...], erweisen sich die von den jeweiligen Habitus erzeugten Praxisformen als systematische Konfigurationen von Eigenschaften und Merkmalen und darin als Ausdruck der Unterschiede, die, den Existenzbedingungen in Form von Systemen differenzieller Abstände eingegraben und von den Akteuren mit den erforderlichen Wahrnehmungs- und Beurteilungsschemata zum Erkennen, Interpretieren und Bewerten der relevanten Merkmale wahrgenommen, als Lebensstile fungieren. - Der Habitus ist nicht nur strukturierende, die Praxis wie deren Wahrnehmung organisierende Struktur, sondern auch strukturierte Struktur: das Prinzip der Teilung in logische Klassen, das der Wahrnehmung der sozialen Welt zugrunde liegt, ist seinerseits Produkt der Verinnerlichung der Teilung in soziale Klassen."[37]
Unter 'Habitus' ist also eine Vermittlungskategorie zwischen individueller Person und sozialer Struktur bzw. Umwelt zu verstehen.[38] Dabei ist der Habitus sowohl "Erzeugungsprinizip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis" als auch "Klassifikationssystem (principium divisionis) dieser Formen":
In der Beziehung dieser beiden den Habitus definierenden Leistungen: der Hervorbringung klassifizierbarer Praxisformen und Werke zum einen, der Unterscheidung und Bewertung der Formen und Produkte (Geschmack) zum anderen, konstituiert sich die repräsentierte soziale Welt [...]. [...] Der Habitus bewirkt, daß die Gesamtheit der Praxisformen eines Akteurs [(...)] als Produkt der Anwendung identischer (oder wechselseitig austauschbarer) Schemata zugleich systematischen Charakter tragen und systematisch unterschieden sind von den konstitutiven Praxisformen eines anderen Lebensstils.[39]
In den Kategorien naiv und sentimentalisch bzw. in den dahinter stehenden Beschreibungsprofilen, wie sie Schiller in der Korrespondenz mit Goethe und z.T. zeitgleich in den kunstphilosophischen Schriften ausführlich entwirft, formiert sich damit erstmals ein spezifisch literarischer Habitus bzw. eine Habitus-Opposition literarischer Autorschaft - auch dies eine epochale Leistung Schillers bzw. eine gemeinsame Errungenschaft aus der Verbindung Goethe-Schiller. Dabei wäre es unrichtig, resp. eine unzulässige Verkürzung, nun kurzerhand von einem 'Habitus des naiven' bzw. des 'sentimentalischen Dichters' zu sprechen, ebenso wie es unzulässig ist, Goethe auf den naiven, Schiller auf den sentimentalischen Dichter festzulegen.[40]
Entscheidend ist vielmehr, daß in der Begegnung zwischen Schiller und Goethe eine soziale Verfahrenspraxis beobachtbar ist, in der das wechselseitige Schaffen und die Person auf einen je spezifischen literarischen Habitus bzw. eine Habitusdisposition hin wahrgenommen und interpretiert werden, wofür die Begriffspaare 'naiv'-'sentimentalisch' bzw. 'intuitiv'-'spekulativ' lediglich Annäherungswörter sind. Als je eigene poetologische Weisen künstlerischer Produktivkraft implizieren diese Habitusdispositionen zudem unterschiedliche Formen von "inkorporiertem kulturellem Kapital" wiederum im Sinne Bourdieus.[41] Schiller selbst legitimiert uns, diese möglicherweise befremdliche Terminologie hier zu gebrauchen, finden wir doch in seinem zweiten Brief von Ende August 1794 einen Passus, wo er sich in einer semantisch ganz ähnlichen Metaphorik bewegt:
"Erwarten Sie bei mir keinen großen materialen Reichtum von Ideen; dies ist es, was ich bei Ihnen finden werde. Mein Bedürfnis und Streben ist, aus wenigem viel zu machen, und wenn Sie meine Armut an allem, was man erworbene Erkenntnis nennt, einmal näher kennen sollten, so finden Sie vielleicht, daß es mir in manchen Stücken damit mag gelungen sein. Weil mein Gedankenkreis kleiner ist, so durchlaufe ich ihn eben darum schneller und öfter [...]. Sie bestreben sich, Ihre große Ideenwelt zu simplifizieren, ich suche Varietät für meine kleinen Besitzungen. Sie haben ein kleines Königreich zu regieren, ich nur eine kleine Familie von Begriffen, die ich herzlich gern zu einer kleinen Welt erweitern möchte."[42]
Hier tritt neben der Tatsache des Stilisierungsverfahrens der dichterischen Existenz der beiden zu einem literarischen Habitus jenes zweite wichtige Element in der Regelung der Freundschaftsbeziehung Goethe-Schiller mit aller wünschenswerten Deutlichkeit hervor: Dessen konstruktive Anlage auf eine Komplementär-Opposition: Der eine hat, was dem andern abgeht.
In einem Bericht über die Begegnung in der Naturforschenden Gesellschaft an seinen Freund Körner, geschrieben wenige Tage nach dem Geburtstagsbrief (1. Sept. 1794), spricht dies Schiller denn auch deutlich aus: "Ein jeder konnte dem andern etwas geben, was ihm fehlte, und etwas dafür empfangen. Seit dieser Zeit haben diese ausgestreuten Ideen bei Goethe Wurzel gefaßt, und er fühlt jetzt ein Bedürfniß, sich an mich anzuschließen, und den Weg, den er bisher allein und ohne Aufmunterung betrat, in Gemeinschaft mit mir fortzusetzen."[43]
Damit wird die Verbindung zwischen den beiden auch zu einem Forum des Tausches, und zwar des Tausches symbolischer Güter und kulturellen Kapitals. Dies wiederum bringt mit sich: die bilanzierende Figur der Buchhaltung. Sie ist also konstitutives Element der Verbindung, sozusagen ein Baustein in der von Goethe und Schiller selbst errichteten Konstruktion ihrer Beziehung. - Nicht zuletzt deshalb auch kann eine 'kritische Bilanz' kaum unternommen werden, ohne daß wir die Konstruktion der getroffenen Ordnung selber wiederum fortschreiben.
Fragen wir uns zum Abschluß, was Sinn und Funktion dieser Ordnungskonstruktion in der Beziehungsgestaltung sein könnten. Vereinfachend möchte ich zwei Ebenen ihrer Wirksamkeit unterscheiden:
Auf einer ersten Ebene, der Schnittebene von Persönlichkeit, Charakteranlage und schriftstellerisch-öffentlichem Wirken, werden die damit getroffenen Unterscheidungen und Ordnungskategorien zum handlungsleitenden Regulativ der wechselseitigen Beziehungsgestaltung im privaten wie im schriftstellerischen Raum. Oder anders gesagt: Durch die Stilisierung und im Medium der komplementär-symmetrischen Stilisierung kann ihre freundschaftliche Verbindung zur Sphäre eines symbolischen Tausches von unterschiedlichen Arten künstlerischer Produktivität und eines unterschiedlichen literarischen Habitus werden. Sie wird gewissermaßen zum Ort einer geteilten Autorschaft - durchaus in der doppelten Wortbedeutung. Nur nebenbei sei vermerkt, daß diese Verbindung zu einem symbolischen Tauschmarkt der eigenen unterschiedlich definierten Produktivitätsformen natürlich auch eine geschickte Strategie zur Vermeidung der gegenseitigen Konkurrenzierung auf dem realen ökonomischen Markt der Literatur darstellte.
Ein für die Entwicklung der modernen Kunst und Literatur viel bedeutungsreicherer Aspektzusammenhang ist indessen der folgende: Pierre Bourdieu hat auf eine paradoxe Konstellation hingewiesen, welche mit der Autonomisierung von Kunst und Literatur in der Moderne einhergeht:[44] Indem der moderne Schriftsteller auf die ästhetische Eigengesetzlichkeit seines Kunstschaffens pocht, also nur gelten lassen will, was ihm sein ästhetisches Empfinden und sein Kunstverstand eingeben, verweigert er sich zugleich dem literarischen Markt bzw. den ökonomischen Gesetzen des Marktes. In der Tat spaltet sich ja der literarische Markt mit dem Aufkommen der modernen Autonomieästhetik in zwei völlig unterschiedliche Literaturen auf: einerseits in jene Literatur, die marktgesteuert funktioniert, aber symptomatischerweise ästhetisch als Trivial- oder Massenliteratur disqualifiziert wird, und andererseits in die ästhetisch hochbewertete Literatur, die aber nicht oder nur in wenigen Fällen auch marktökonomisch ihren Wert erbringt. Bourdieu nennt dies "le monde économique à l'envers": l'artiste ne peut triompher sur le terrain symbolique qu'en perdant sur le terrain économique (au moins à court terme), et inversement (au moins à long terme)."[45] In der Tat können wir gerade bei Schiller und Goethe beobachten, wie die Bemühungen um die Entwicklung der Eigengesetzlichkeit der Literatur, und das heißt ihrer autonomen Gesetzmäßigkeiten, in ihren Gesprächen wie in ihrem Schaffen eine ganz zentrale Rolle spielen. Dies schließt eine z.T. sehr prononcierte Polemik gegen das Publikum, gegen die Literaturkritik und gegen andere Schriftsteller ein bzw. artikuliert sich gerade darin.[46]
In gewisser Weise koppeln sich damit die beiden aber auch vom literarischen Markt ab, von dem sie - zumindest Schiller - ökonomisch zugleich abhängig sind. Umso wichtiger werden sie sich nun selbst, indem sich das Forum des literarischen Tausches auf den kleinen "Binnenmarkt" ihres beidseitigen Tauschgesprächs zu literarischen Fragen in der Entstehung ihrer Werke zurückzieht. Dies im einzelnen aufzuweisen fehlt hier die Zeit. Nur am Beispiel der Metaphern-Opposition 'Körper' / 'Idee', die Schiller im Geburtstagsbrief bezogen auf Goethe und sich selbst aufgebaut hatte, und an deren Fortschreibung durch Goethe sei kurz gezeigt, wie ihre Verbindung, basierend auf der Komplementär-Differenz ihres je unterschiedlichen Habitus zum Medium eines in sich geschlossenen Regelkreises des literarischen Tausches wird: Im Zusammenhang mit Wilhelm Meister schreibt Goethe am 10. August 1796, d.h. zwei Jahre nach dem Geburtstagsbrief:
"Ich habe zu Ihren Ideen Körper nach meiner Art gefunden, ob Sie jene geistigen Wesen in ihrer irdischen Gestalt wieder kennen werden, weiß ich nicht. Fast möchte ich das Werk zum Drucke schicken, ohne es Ihnen weiter zu zeigen. Es liegt in der Verschiedenheit unserer Naturen, daß es Ihre Forderungen niemals ganz befriedigen kann, und selbst das gibt, wenn Sie dereinst sich über das Ganze erklären, gewiß wieder zu mancher schönen Bemerkung Anlaß."[47]
Nicht nur weist die Körper-Metaphorik auf den gleichsam organischen Geschlossenheitscharakter ihrer geteilten Autorschaft hin, [48] der zweite Teil des Zitats bringt auch ein leises Unbehagen Goethes daran zum Ausdruck. Anders wiederum im Neujahrsbrief vom 6. Januar 1798 erneut Goethe, der hier den regulativen Charakter der Typisierungs-Opposition und ihre wohltätige Wirkung ausdrücklich hervorhebt:
"Wenn ich Ihnen zum Repräsentanten mancher Objekte diente, so haben Sie mich von der allzu strengen Beobachtung der äußern Dinge und ihrer Verhältnisse auf mich selbst zurückgeführt, Sie haben mich die Vielseitigkeit des innern Menschen mit mehr Billigkeit anzuschauen gelehrt, Sie haben mir eine zweite Jugend verschafft und mich wieder zum Dichter gemacht, welches zu sein ich so gut als aufgehört hatte."[49]
Die Komplementär-Figur der Habitusdifferenz in Verbindung mit der des symbolischen Tausches durchwirkt als Rollen- und Figurenspiel die verschiedensten Lebensaspekte der beiden und kann sogar zum eigentlich inszenierten Spiel bis hin zum humoristisch durchgespielten Verwandtschaftstausch gehen: Als Goethe im Oktober 1795 einen "neuen Weltbürger in [s]einem Hause" ankündigt, bittet Schiller, der Vater eines Knaben ist, postwendend: "Lassen Sie ihn immer ein Mädchen sein, so können wir uns noch am Ende miteinander verschwägern." - Goethe greift den Wunsch sogleich auf und schreibt in einem Nachsatz zum Brief zwei Tage später: "Das Schwiegertöchterchen säumt noch." Und als dann "statt eines artigen Mädchens [...] endlich ein zarter Knabe angekommen" ist, wiederum Goethe: "Nun wäre es an Ihnen, zur Bildung der Schwägerschaft und zur Vermehrung der dichtrischen Familie für ein Mädchen zu sorgen."[50]
Kommen wir abschließend zur zweiten Sinn- und Funktionsebene der wechselseitigen Ordnungskonstruktion: Ich habe vorhin gesagt, im Medium der komplementär-symmetrischen Stilisierung werde die Verbindung zwischen Goethe und Schiller zum Ort einer geteilten Autorschaft in einer doppelten Wortbedeutung: Geteilt einmal im Sinne einer gemeinsamen Autorschaft, d.h. einer Gemeinsamkeit der Autorschaft, wo sich dann sogar die Grenze zwischen dem einen und dem andern Autor verwischen und die Frage Foucaults: "Was ist ein Autor?" akut werden möchte. Geteilt aber auch in dem andern Sinne, daß Autorschaft ein Geteiltes, nicht ein vollständiges Ganzes und Einfaches sei. Diese beiden Bedeutungsaspekte laufen indessen nicht einfach als alternative Möglichkeiten nebeneinander her, sondern die eine ist das Symptom der andern. D.h.: Die gemeinsam geteilte Autorschaft ist Symptom dafür, daß der einzelne Autor - und heiße er selbst 'Goethe' - ein geteilter Mensch und 'begrenzter' Dichter ist.
Ü ber den Tatbestand dieser geteilten Existenz des modernen Menschen und deren gesellschaftliche Ursachen handeln nicht nur Schillers philosophische Schriften in aller Gründlichkeit, insbesondere die Briefe über die ästhetische Erziehung, ebenso etwa Goethes polemischer Aufsatz über Literarischen Sanscülottismus, auf den persönlichen Erfahrungskreis bezogen finden sich darüber auch im Briefwechsel der beiden immer wieder Hinweise.[51] Und in der Tat ist ja das Tauschbündnis in der Konstruktion von Schillers Geburtstagsbrief auf den beidseitigen Mangel angelegt. Diese Einsicht in den Autor als Mängelwesen kontrastiert nun freilich scharf mit der Vision des Dichters als des alleinigen und vollkommenen Repräsentanten der Menschheit, wie sie seit Schillers Rezension von Bürgers Gedichten von 1791 als klassisches Postulat dessen Ästhetik bestimmt und auch in den beidseitigen Briefen und Äußerungen zur Kunst immer wieder auftaucht.
Wohl ist auch für Schiller von der partikularen Subjektivität des Individuums als der Quelle und dem Ursprung des kreativen Schaffens des modernen Schriftstellers auszugehen: "[...] Alles, was der Dichter uns geben kann, ist seine Individualität."[52] Aber daran schließt sich sogleich die Verpflichtung zu einem allgemeingültigem Repräsentanzstreben an: "Diese muss es also wert sein, vor Welt und Nachwelt ausgestellt zu werden." Das geschieht dadurch, daß der Dichter "seine Individualität so sehr als möglich [veredelt], zur reinsten herrlichsten Menschheit [hinaufläutert]", [53] daß er "das Individuelle und Lokale zum Allgemeinen", [54] die "selbsteigene Person" zum Repräsentanten der "Gattung"[55] erhebt. "Alles, wozu Erfahrungen, Aufschlüsse, Fertigkeiten gehören, die man nur in positiven und künstlichen Verhältnissen erlangt, müßte er sich sorgfältig untersagen [...]", [56] wenn es darum geht, "die höchste Krone der Klassizität zu erringen".[57]
Später heißt es in einem Brief Schillers an Goethe: "So viel ist indes gewiß, der Dichter ist der einzige wahre Mensch"[58] - Bei Goethe wiederum lesen wir: "Jede Kunst verlangt den ganzen Menschen, der höchstmögliche Grad derselben die ganze Menschheit"[59] - Und erneut Schiller:
"Es ist ein Bedürfnis poetischer Naturen, [...] so wenig Leeres als möglich um sich zu leiden, so viel Welt, als nur immer angeht, sich durch die Empfindung anzueignen, die Tiefe aller Erscheinungen zu suchen und überall ein Ganzes der Menschheit zu fodern. [...] Nichts, außer dem Poetischen, reinigt das Gemüt so sehr von dem Leeren und Gemeinen, als diese Ansicht der Gegenstände, eine Welt wird dadurch in das Einzelne gelegt, und die flachen Erscheinungen gewinnen dadurch eine unendliche Tiefe. Ist es auch nicht poetisch, so ist es, wie Sie selbst es ausdrücken, menschlich; und das Menschliche ist immer der Anfang des Poetischen, das nur der Gipfel davon ist."[60]
Daß die Vision dieses Dichtertums ungeteilter, universeller Menschlichkeit in die 'geteilte' Autorschaft ihrer Verbindung hineinspielt und da als Movens mitwirkt, belegt eine Stelle, wo aus der geteilten sogar eine chiastisch vertauschte[61] Autorschaft wird, die Goethe dann auch tatsächlich auf eine kollektiv ganzheitliche hin kommentiert. Schiller berichtet Goethe, daß man ihrer beider Werke im Publikum bereits zu verwechseln beginne: "Das Glück, welches das kleine Gedicht Die Teilung der Erde zu machen scheint, kommt mit auf Ihre Rechnung, denn schon von vielen hörte ich, daß man es Ihnen zuschreibt. Hingegen ist mir von andern der Literarische Sanscülottism zugeschrieben worden."[62] - Dazu Goethes Antwort: "Daß man uns in unsern Arbeiten verwechselt, ist mir sehr angenehm; es zeigt, daß wir immer mehr die Manier los werden und ins allgemeine Gute übergehen. Und dann ist zu bedenken, daß wir eine schöne Breite einnehmen können, wenn wir mit Einer Hand zusammenhalten und mit der andern so weit ausreichen, als die Natur uns erlaubt hat."[63]
So ermöglicht es das Verfahren der 'Stilisierung' zu zwei oppositionellen literarischen Habitus-Typen und deren Vereinigung zu einer Konstellation, die selbst den Fall eines symbolischen Autortausches in sich einschließt, die Vision des Dichters als des alleinigen und vollständigen Repräsentanten der Menschheit unter den heteronomen Produktionsbedingungen des literarischen Marktes in der komplementären Selbstbespiegelung geteilter Autorschaft wenigstens symbolisch wenn schon nicht ökonomisch zu behaupten.
Prof. Dr. Michael Böhler
Deutsches Seminar der
Universität Zürich
Schönberggasse 9
CH-8001 Zürich
Homepage des Seminars
Copyright © by the author. All rights reserved.
Erstpublikation: Goethe-Jahrbuch, im Auftrag des Vorstands der Goethe-Gesellschaft heausgegeben von Werner Keller, 112. Band der Gesamtfolge 1995. Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger: Weimar 1996, Seite 167-181. Der Beitrag wurde eingescannt und redigiert.
Der Aufsatz Die Freundschaft von Schiller & Goethe als literatursoziologisches Paradigma arbeitet weitere Aspekte des Themas heraus.
Anmerkungen
[1] Thomas Mann: Die unsterbliche Freundschaft. In: Akzente 2 (1955), S. 205.
[2] Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe, hrsg. von Fritz Bergemann. Frankfurt 1981 (1955), Bd. 1, S. 148: "Nun streitet sich das Publikum seit zwanzig Jahren, wer größer sei: Schiller oder ich, und sie sollten sich freuen, daß überhaupt ein paar Kerle da sind, worüber sie streiten können."
[3] Hans Mayer: Goethe. Ein Versuch über den Erfolg. Frankfurt/Main 1973, S. 57.
[4] Auch Wilfried Barner spricht in der Einleitung zu: Unser Commercium. Goethes und Schillers Literaturpolitik, hrsg. von Wilfried Barner u.a., Stuttgart 1984 (Veröffentlichungen der Deutschen Schillergesellschaft, Bd. 42) von der "gezielte[n] Stilisierung nach außen, die schließlich mithalf, den vielgescholtenen Dioskurenmythos zu begründen." (S. 15)
[5] Jürgen Link: Die mythische Konvergenz Goethe-Schiller als diskurskonstitutives Prinzip deutscher Literaturgeschichtsschreibung im 19. Jahrhundert. In: Der Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie: Wissenschaftsgeschichte als Innovationsvorgabe, hrsg. von Bernhard Cerquiglini und Hans Ulrich Gumbrecht. Frankfurt/M. 1983, S. 225-242; bes. S. 227 u. 231f.
[6] Mayer (Anm. 3), S. 58.
[7] Emil Staiger: Fruchtbare Mißverständnisse Goethes und Schillers. In: E. St.: Spätzeit. Studien zur deutschen Literatur. Zürich u. München 1973, S. 33ff.
[8] Benno von Wiese: Goethe und Schiller im wechselseitigen Vor-Urteil. In: B.v.W.: Von Lessing bis Grabbe. Düsseldorf 1968. S. 111-137.
[9] Georg Luk‡cs: Goethe und seine Zeit. Bern 1947, S. 52.
[10] H. Pyritz: Der Bund zwischen Goethe und Schiller (1950). In: Begriffsbestimmung der Klassik und des Klassischen, hrsg. von Heinz O. Burger. Darmstadt 1972, S. 313.
[11] Eckhardt Meyer-Krentler: Freundschaft im 18. Jahrhundert. Zur Einführung in die Forschungsdiskussion. In: Frauenfreundschaft - Männerfreundschaft. Literarische Diskurse im 18. Jahrhundert, hrsg. von Wolfram Mauser und Barbara Becker-Cantarino. Tübingen 1991. S. 7.
[12] Wolfgang Fahs: Zum Verhältnis Goethe-Schiller. In: Frauenfreundschaft - Männerfreundschaft (Anm. 11), S. 137.
[13] Unser Commercium (Anm. 4)
[14] Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, hrsg. von Emil Staiger. Frankfurt 1966, S. 31.
[15] Brief vom 28. Juni 1794; Goethes Briefe. Hamburger Ausg. in vier Bde., textkrit. durchgesehen und mit Anm. versehen von Karl Robert Mandelkow. Hamburg 1964, Bd. 2, S. 179.
[16] Briefwechsel (Anm. 14), S. 33.
[17] Briefwechsel (Anm. 14), S. 37.
[18] Briefwechsel (Anm. 14), S. 37.
[19] Briefwechsel (Anm. 14), S. 45.
[20] Briefwechsel (Anm. 14), S. 51.
[21] Briefwechsel (Anm. 14), S. 55f.; der Brief, von dem ein Bruchstück im Konzept erhalten ist, sollte zu einer geplanten Korrespondenz über das Schöne gehören.
[22] Jürgen Fohrmann: "Wir besprächen uns in bequemen Stunden....". Zum Goethe-Schiller Verhältnis und seiner Rezeption im 19. Jahrhundert. In: Klassik im Vergleich. Normativität und Historizität europäischer Klassiken. DFG-Symposium 1990, hrsg. von Wilhelm Voßkamp. Stuttgart 1993, S. 573.
[23] HA, Bd. 10, S. 538.
[24] Schillers Werke. Nationalausgabe, hrsg. von Liselotte Blumenthal. Weimar 1961, Bd. 25, S. 191f.
[25] Gespräche mit Eckermann (Anm. 2); Gespräch vom 24. März 1829: "So waltete bei meiner Bekanntschaft mit Schillern durchaus etwas Dämonisches ob; wir konnten früher, wir konnten später zusammengeführt werden; aber daß wir es gerade in der Epoche wurden, wo ich die italienische Reise hinter mir hatte und Schiller der philosophischen Spekulationen müde zu werden anfing, war von Bedeutung und für beide von größtem Erfolg."
[26] Gezählt nach der Ausgabe des Briefwechsel von E. Staiger (s. Anm. 14)
[27] Briefwechsel (Anm. 14), S. 733.
[28] Christian Dietrich Grabbe: Etwas über den Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe (1830); abgedruckt in: Goethe im Urteil seiner Kritiker, hrsg. von Karl Robert Mandelkow. Teil I. München 1975, S. 462ff.
[29] WA IV, 45, S. 117f.
[30] Unser Commercium (Anm. 4), S. 373.
[31] Briefwechsel (Anm. 14), S. 58.
[32] Briefwechsel (Anm. 14), S. 35.
[33] Ilse Graham: "Zweiheit im Einklang" Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. In: Goethe-Jahrbuch 95 (1978), S. 34.
[34] "In diesen ersten drei Briefen - dem Geburtstagsbrief, Goethes Antwort vom 27. August und Schillers ergänzender Selbstschau vom 31. August - sind faktisch so gut wie alle Themen angeschlagen, die dann im Briefwechsel der nächsten zehn Jahre zum Tragen kommen: [...] [a] Themenkreis der Unzeitgemäßheit [...] [b] Thematik von Idee und Erfahrung, Rationalismus und Empirismus, Weltfremdheit und Welthaltigkeit [...] [c] Schöpferisches als reflektierende oder unbewußtes Verhalten [...] [d] Begriff der Wechselwirkung selbst [...]." Graham (Anm. 33), S. 37.
[35] Briefwechsel (Anm. 14), S. 43.
[36] Peter Szondi: Das Naive ist das Sentimentalische. Zur Begriffsdialektik in Schillers Abhandlung. In: P.S.: Schriften II, hrsg. von Jean Bollack u.a. Frankfurt 1978, S. 59-105.
[37] Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt/M. 21983, S. 278f.
[38] "Der Habitus ist Produkt kollektiver Geschichte und individueller Erfahrung, stimmt objektive Chancen und subjektive Aspirationen aufeinander ab, stiftet Realitätssinn und den Sinn für die eigenen Grenzen und integriert klassenspezifische Verhaltensformen mit nutzenorientierten Strategien." Hans-Peter Müller: Kultur, Geschmack und Distinktion. Grundzüge der Kultursoziologie Pierre Bourdieus. In: Kultur und Gesellschaft, Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, hrsg. von Friedhelm Neidhart u.a., Köln 1986, S. 163.
[39] Bourdieu (Anm. 37), S. 277f.
[40] Szondi (Anm. 36)
[41] "Inkorporiertes Kulturkapital ist im Prozeß der Sozialisation in Familie und Schule verinnerlichtes, [...] dispositionell verkörpertes Potential einer Person, das als Kompetenz im kognitiven Sinne oder als Geschmack im ästhetischen Sinne fungiert [...]. 'Inkorporiertes Kapital ist ein Besitztum' das zu einem festen Bestandteil der 'Person', zum Habitus geworden ist; aus 'Haben' ist 'Sein' geworden. (Bourdieu: …konomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, S. 187)." Hans-Peter Müller (Anm. 38), S. 167.
[42] Briefwechsel (Anm. 14), S.42f.
[43] Schillers Werke (s. Anm. 24), Bd. 27, S. 34f.
[44] Pierre Bourdieu: Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire. Paris 1992. S. 121-126.
[45] Bourdieu (Anm. 44), S. 121.
[46] Exemplarisch dafür der Xenienkampf; vgl. dazu am ausführlichsten: Franz Schwarzbauer: Die Xenien. Studien zur Vorgeschichte der Weimarer Klassik. Stuttgart 1992.
[47] Briefwechsel (Anm. 14), S. 271.
[48] Eine andere Stilisierungsvariante, die vor allem in der Klassikrezeption eine bedeutende Rolle spielt, vollzieht sich in der symbolischen Ordnung des Geschlechterdiskurses, worin sich in der Verbindung von Goethe-Schiller weiblich-männliche Konstellationen reflektieren; vgl. dazu: Link (Anm. 5), S. 227f.; Fohrmann (Anm. 22), S. 584.
[49] Briefwechsel (Anm. 14), S. 536.
[50] Briefwechsel (Anm. 14), S. 149-153.
[51] Ausführlicher dazu: Michael Böhler: Die Freundschaft von Schiller und Goethe als literatursoziologisches Paradigma. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur (IASL), 5 (1980), S. 33f. und 60-65.
[52] Schillers Werke (s. Anm. 24), Bd. 22, S. 246.
[53] Schillers Werke (s. Anm. 24), Bd. 22, S. 246.
[54] Schillers Werke (s. Anm. 24), Bd. 22, S. 253.
[55] Schillers Werke (s. Anm. 24), Bd. 22, S. 261.
[56] Schillers Werke (s. Anm. 24), Bd. 22, S. 248.
[57] Schillers Werke (s. Anm. 24), Bd. 22, S. 259.
[58] Briefwechsel (Anm. 14), S. 81.
[59] Einleitung in die Propyläen. In: HA 12, S.54.
[60] Briefwechsel (Anm. 14), S. 462f.
[61] vgl. dazu auch: Link (Anm. 5), S. 232f.
[62] Briefwechsel (Anm. 14), S. 173.
[63] Briefwechsel (Anm. 14), S. 176f.